
Ein bisschen Spaß muss sein: Am nächsten Sonnabend erwartet Dublin wieder mehr als eine Million Zuschauer zur St.-Patrick’s-Day-Parade.
Foto: Oppermann
Von Christoph Oppermann
„Are you brilliant?“ Der Kollege aus Los Angeles hatte als Erster seine beobachtende Zurückhaltung aufgegeben. „ARE – YOU – BRILLIANT??“ St. Patrick’s Day ist ansteckend. Wer es bis dahin nicht wusste – gleich, ob auf dem Pressebus oder entlang der Strecke, die die Parade nahm –, der wusste es jetzt: Der Mann aus den USA war nur begrenzt originell. Denn erstens sind Dublin und Dubliner selbstverständlich brillant, wenn auch mitunter auf eine sehr spezielle Weise: Wo sonst würde man in Anspielung auf die Untergrundorganisation IRA T-Shirts mit dem lapidaren Hinweis „Dublin – The City That Fought an Empire“ verkaufen? Und zweitens sind die irische Hauptstadt und ihre Bürger sogar so brillant, dass Roddy Doyle, Autor des Kultbuches „The Commitments“, ihnen eine eigene Kurzgeschichte zur St-Patrick’s-Day-Parade geschrieben hat. Titel: „Brilliant“.
„Are you brilliant?“ „We are brilliant!“ Die Menschenmassen können – auch in nur kleineren Gruppen entsprechend befragt – eindrucksvoll Antwort geben. Der Pressebus führt die Parade an, der Blick nach hinten ist atemberaubend: Hunderttausende – Dubliner wie Besucher – säumen die Straßen entlang der Festzugsroute. Die führt vom Norden am General Post Office vorbei, wo einst mit dem Osteraufstand die Grundzüge der heutigen irischen Republik gelegt wurden, über den Liffey-Fluss direkt in den Südteil der Stadt.
Die meisten Schaulustigen stehen da mit grünen Haaren, grünen Hüten und grünem Klee an der Jacke. Denn Grün ist die Nationalfarbe Irlands. Zwischendurch gibt es immer ein paar optische Ausreißer: Zeitgenossen im St.-Patrick’s- Kostüm. Denn der Nationalheilige ist Namensgeber dieses Tages, der so etwas wie der irische Nationalfeiertag ist. Schließlich soll es der heilige Patrick gewesen sein, der die Insel einst von den Schlangen befreit hat.
Alle warten auf die Parade, die aus einer bunten Mischung von Organisationen, Vereinen und Verbänden aus ganz Irland und aller Herren Länder besteht. Von der Brass-Band aus den Vereinigten Staaten bis zur Turnkindergruppe aus einem Vorort der Hauptstadt, von der Dublin Fire Brigade in Kilts bis zur Folkloretanzgruppe. Dazu Musik. Musik von vorn und von hinten, laut, kräftig, fröhlich. Traditionelles aus irischen und schottischen Dudelsäcken konkurriert mit südamerikanischen Rhythmen und ordentlicher Rockmusik.
Prominenteste Gäste entlang der Festzugsroute sind in jedem Jahr der Bürgermeister von Dublin und der Präsident der Republik Irland. Dazu schier unzählige Fernsehteams. Die St.-Patrick’s-Day-Parade ist längst auch ein Medienspektakel geworden, das in zahlreiche Länder übertragen wird. Jahr für Jahr.
Eine eigene Kurzgeschichte vom „Commitments“-Autoren zu bekommen ist eine Sache, daraus gleich einen ganzen Umzug zum Nationalfeiertag zu machen, eine ganz andere. Der St. Patrick’s Day und die Parade durch die irische Hauptstadt sind sogar norddeutschlandkompatibel. Wer nicht versehentlich aus Braunschweig oder ähnlich speziellen Stadt Niedersachsens stammt, hat üblicherweise ein eher kühles Verhältnis zum Fasching. Doch „Paddy’s Day Party“, wie die Feier im Volksmund heißt, funktioniert anders. Keine Clowns, keine Dominos, keine Ringelshirts unterm Frack, auch Cowboy- und Indianerkostüme sind eher befremdlich. Hilfreich dagegen: rote oder grüne Haare, zur Not auch künstlicher Herkunft, grüne Hüte oder sonstige Accessoires – Hauptsache grün. Notfalls tut es auch eine überdimensionierte Krawatte mit dem Aufdruck „Kiss me, I’m Irish.“
Darum allein geht’s: Irland feiert sich und seinen Nationalheiligen. Kein Mummenschanz, keine Geistervertreibung, kein ritualisiertes Auflehnen gegen Obrigkeiten, einfach ein Fest, das eigentlich kein Ire auslässt, egal, wo auf der Welt er lebt. Und Höhepunkt ist der kilometerlange Festumzug durchs Zentrum der irischen Hauptstadt. Dazu Partys in jedem Pub der Stadt, die eine beneidenswerte Dichte an solcher Gastronomie aufweist.
Dublin ist das Epizentrum der Partys. Längst ist aus dem Nationalfeiertag das St. Patrick’s Festival geworden, das in diesem Jahr vom 16. bis 19. März dauert. Hatte 2011 noch Doyle, Urheber der Barrytown-Trilogie, eine literarische Vorlage geliefert, deren sieben Szenen Tausende von Akteuren in sieben Abschnitten des Festumzuges dargestellt haben, ist das 2012er-Motto nur vermeintlich trockener: Wissenschaft. Eine bewegte Multimediashow droht nicht – der diesjährige Festzug ist mit dem Slogan „The Science of Fun“, Wissenschaft des Spaßes, überschrieben.
Die Organisatoren erwarten mehr als eine Million Zuschauer. Die Akteure der Parade, darunter viele Kinder, sollen Antworten auf zahlreiche Fragen geben, für die bei uns die „Sendung mit der Maus“ zuständig wäre: Wie ist ein Regenbogen beschaffen und geformt? Was verändert das Wetter? Was ist und wie entsteht Elektrizität? Wer Iren und deren etwas anarchischen Humor kennt, freut sich schon auf eine abwechslungsreiche, bunte und einmalige Show. Brillant!
Stichwort: Der Heilige Patrick
Die wohl sichersten Fakten in der St-Patrick-Biografie sind dessen Sterbeort (County Down) und dessen Todestag (17. März). Danach hört es mit den Gewissheiten allerdings auch schon auf – das Todesjahr könnte 461 nach Christi gewesen sein oder auch 493.
Er sei ein in Schottland geborener Sohn eines römischen Offiziers gewesen, der in der nördlichsten Provinz des Reiches, Britannia, stationiert war, behauptet eine Fraktion. Eigentlich sei sein Name Patrick Maewyn gewesen, Geburtsland folglich Wales, behauptet, wenig überraschend, eine walisische Legende.
Sicher ist nicht einmal, aus wie vielen tatsächlichen Biografien sich der Lebensweg des heiligen Patrick zusammensetzt. Egal ob aus Schottland oder Wales stammend, soll er als junger Mann nach Irland verschleppt worden sein und hat angeblich nach Flucht und theologischer Ausbildung Außerordentliches geleistet: Irland so gründlich durchmissioniert, dass es vielen heute noch als das katholischste Land der Welt gilt, und mit seinem Bischofsstab so tüchtig, auf den Boden gestoßen haben, dass alle Schlangen das Weite gesucht haben und Irland seither frei von solcherlei Getier ist.
Auch die Angelegenheit mit der Dreifaltigkeit – Stunde der Wahrheit in jeder Religionsprüfung – soll er den bis dahin heidnischen Iren einfach und einleuchtend erklärt haben: anhand des dreiblättrigen Klees, der heute die Nationalpflanze Irlands ist. / to



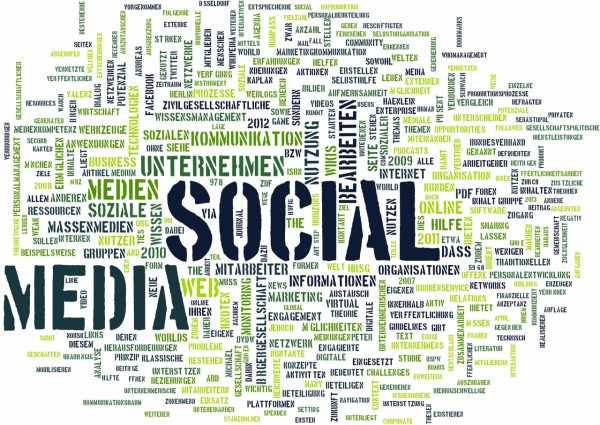
Neueste Kommentare