Da sind sie wieder. Meine Lieblingsdiskussion. Meine Lieblingsstichworte. Jedenfalls, wenn es ums Mediengeschäft geht. Paid Content, Bezahlmodelle, die Frage nach dem Königsweg.
Angestoßen hat die neue Runde um Entgelt für redaktionelle Inhalte im Netz Richard Gutjahr, der in seinem Beitrag „Paid Content: Ein neues Bezahlmodell für Journalismus“ LaterPay vorgestellt hat. Axel Wagner hat die Alltagstauglichkeit des neuen Ansatzes bereits mit seiner Überschrift „Journalismus: Später zahlen – oder gar nicht?“ in Zweifel gezogen. Den Kern des neuen Modells erklärt Richard Gutjahr mit einer Kneipen-Analogie: Bezahlt wird zum Schluss, und zwar das, was auf dem Deckel steht. Schlüssig klingt dabei auf jeden Fall der Ansatz, die Hemmschwelle vor einem Bezahlvorgang so niedrig wie möglich zu gestalten. Es ist gelegentlich einfach eine Frage der Bequemlichkeit, nicht noch eine weitere Anmeldung mit E-Mailadresse und Passwort vornehmen zu wollen.
Axel Wagner äußert reichlich Zweifel, und einige muss man sicher haben. Die Annahme, dass Kunden gern bezahlen, ist sagenwirmal lebensbejahend. Hoffnungsvoll. Die Gutjahr-Herleitung, Kunden müssten das Gefühl bekommen, fair behandelt zu werden, ist allerdings unbedingt richtig und wichtig. Aber so wenig diese Annahme vollkommen „weiß“ funktioniert, so wenig stimmt auch die schwarze Ausgangsannahme, überall herrsche Geiz-ist-Geil-Mentalität. Nichts von beidem ist ultimativ richtig.
Im Wesentlichen haben wir es bei der Frage nach Bezahlmodellen für Onlinejournalismus mit zwei Problemen zu tun:
Gratiskultur: Die beklagt praktisch jeder bei uns in der Branche, doch verantwortlich für den Anspruch von Nutzern, im Netz müsse möglichst alles kostenlos sein, sind weder das Internet an sich noch der Nutzer im Besonderen. Das sind wir. Verlage, Verlagsmanager und Journalisten. Wir alle haben vor gut zehn Jahren begonnen, die Inhalte, für deren gedruckte Version wir Geld verlangt haben (und es immer noch tun), kostenlos im Netz zur Verfügung zu stellen. Der Rückschluss bei unseren Kunden, wir ließen uns fürs Drucken, aber nicht fürs Recherchieren und Schreiben bezahlen, ist dabei fast zwangsläufig. Das ist irreversibel, sollte aber nicht vergessen werden. Uns hat kein Schicksal ereilt, wir haben die Weichen selbst gestellt. Außerdem wird jeder, der im Netz für ordentliche Inhalte Geld verlangt, Rechtfertigungsschwierigkeiten haben. Ursache dafür sind nicht die Gratis-Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender, sondern vielmehr Titel wie der SPIEGEL. Solange dieses Magazin hervorragende Beiträge kostenlos zur Verfügung stellt (und andere Publikationen ebenfalls), wird es jedenfalls nicht leichter, für online verbreitete Inhalte ein angemessenes Entgelt zu verlangen. Die Hoffnung allerdings, sämtliche Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sowie alle Freien, die online publizieren, könnten sich auf das Ziel einigen, nichts mehr zu verschenken, ist mindestens atemberaubend. Und wird immer nur Hoffnung bleiben. Das hat auch mit dem zweiten Kernproblem zu tun.
Vertriebswege: Über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg haben Tageszeitungen und Magazine einen unglaublichen Luxus genossen. Sie sind mit lediglich einem Produkt und zwei Wegen der Verbreitung ausgekommen. Entweder hat man seine Zeitungen an der Straße ausgelegt, und die Kunden haben das Produkt halbwegs verlässlich gekauft, oder die Kunden haben uns in so großem Maße vertraut, dass wir uns montatlich oder quartalsweise an deren Konto bedienen konnten und dafür bis 6 Uhr ein Produkt in den Briefkasten geliefert haben, dessen Inhalt sie vorher bestenfalls erahnen konnten. Davon träumt jeder Lebensmittelhändler, der jede Tüte Milch einzeln an den Mann oder die Frau bringen muss. Diese komfortable Situation war allerdings nicht dazu geschaffen, in Verlagen kreativ nach neuen, zukunftsfähigen Vertriebswegen zu suchen.
Online funktioniert das aber nicht mehr. Jetzt gibt es mehr als ein Produkt. Jedenfalls sollte es das. Wer glaubt, die digitale Antwort auf Probleme im Absatz gedruckter Tageszeitungen, heiße e-Paper, irrt. Virtuelles Zeitungspapier macht nicht nur keinen Spaß, es ist online auch wenig komfortabel. Inhaltlich jedoch bietet es immer noch ein hohes Maß an Verbindlichkeit. Leider ist es nicht wirklich gut lesbar. Online müssen Geschichten anders aufbereitet sein als in einer gedruckten Ausgabe. Binsenweisheit? Ein Blick in die digitalen Angebote zahlreicher Titel zeigt, dass auch derlei nicht oft genug wiederholt werden kann.
Verändern schon unterschiedliche Papierformate die Darstellungsoptionen, so gilt das für unterschiedliche Ausgabekanäle in noch sehr viel höherem Maß. Wer glaubt, analog zum Papier-Abo ein ultimatives Bezahlmodell für digitale Inhalte zu finden, wird nie zu einer Lösung kommen. Die Antwort kann nur heißen: Wir brauchen nicht ein gutes Modell, wir brauchen viele gute Modelle. So viele gute Modelle, dass wir in möglichst allen digitalen Darstellungsformen einen gangbaren Weg haben und anbieten können. So viele, dass sowohl ein gutes Blog als auch ein Tageszeitungstitel damit angemessen arbeiten können.
LaterPay rettet ganz gewiss nicht das Abendland, sehr sicher auch nicht die gesamte Medienbranche, und vielleicht bringt es nicht einmal Richard Gutjahr nennenswert Geld ein. Aber auf jeden Fall ist LaterPay ein interessantes Modell, das für den einen oder anderen Anbieter genau die richtige Lösung sein kann. Und davon können wir noch eine Menge mehr vertragen.
Übrigens, falls ich es bislang noch nicht erwähnte: Gutjahrs neue Blog-Optik ist einfach sehenswert.
Richard Gutjahr. Paid Content: Ein neues Bezahlmodell für Journalismus
Axel Wagner. Journalismus: Später zahlen – oder gar nicht?

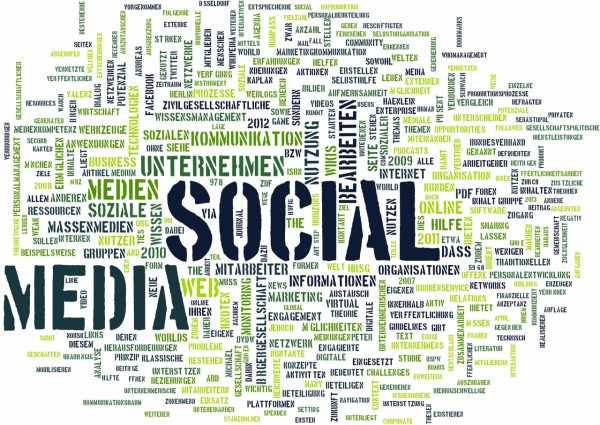
0 Kommentare
3 Pingbacks