
von Christoph Oppermann
Dieses Selbstbildnis ist verräterisch: Wilhelm Busch malte sich in holländischer Tracht – und zwar so, als hätte ein Altmeister des 17. Jahrhunderts zum Pinsel gegriffen. Den holländischen und flämischen Klassikern eiferte er tatsächlich nach, spätestens, nachdem ihn sein Ausbildungsweg von Düsseldorf nach Antwerpen geführt hatte. Genrebilder entstanden, lebenspralle Szenen in bräunlichen Tönen und stimmungsvolle Landschaften. Doch wirken diese Gemälde epigonal. Anerkennung blieb Busch denn auch versagt. Ein gescheiterter Maler, so fing es an.“ Gescheiterter Maler – ein harsches Urteil. Gefällt hat es Volkhard App vor einigen Jahren in einem Beitrag für „DeutschlandRadio Berlin“ anlässlich einer Busch-Ausstellung in Oldenburg.
Dasselbe Werk, andere Perspektive – der Busch-Biograf Martin Tschechne schreibt über das „Selbstbildnis in holländischer Tracht“: „Ein Bild belegt die Tragik einer Künstlerexistenz.“ In diesem Selbstportrait berufe sich Busch überdeutlich auf die großen flämischen Vorbilder, die ihn einst als Student bis zur Lähmung beeindruckt hätten. Und weiter: „Die Malerei sah er fortan nur noch als private Zuflucht – berühmt und wohlhabend aber wurde er als Erfinder und Vorreiter eines Genres, dessen künstlerischen Wert er nie recht akzeptieren mochte: der schnellen, pointierte Karikatur, der launigen Bildergeschichte, des Comic Strip.“ Sehr traditioneller Ansatz – das wäre eine mögliche Wertung Busch’scher Frühwerke im Ressort Malerei. Rückwärts gewandt – ein noch härteres Urteil. Da wirkt der aktuelle Ausstellungstitel des Busch-Museums in Hannover „Avantgardist aus Wiedensahl“ fast wie eine Provokation.
Am 15. April jährt sich Wilhelm Buschs Geburtstag zum 175. Mal. Anlass genug, sich mit dem Mann aus Wiedensahl auseinanderzusetzen. Eines vorweg: Es gibt – mit ziemlicher Sicherheit – keinen ultimativen Zugang zum „Weisen aus Wiedensahl“, keinen Schlüssel, der alles erklärt, alle Widersprüche auflöst. Das macht die Auseinandersetzung mit dem Zeichner, Dichter und vor allem mit dem Maler so interessant. Im Wilhelm-Busch-Jahr werden Einsteigern und Kennern zahlreiche Möglichkeiten geboten, sich über den Wiedensahler zu informieren, sich mit dessen umfangreichen Werk und der gelegentlich sperrig wirkenden Biografie auseinanderzusetzen. Vier dieser zahlreichen Wege scheinen dabei besonders viel zu versprechen.
Vor zwei Jahren hat Martin Tschechne eine brillante Biografie veröffentlicht: „Auf den Spuren von Wilhelm Busch.“ Sicherlich nichts für Puristen. Tschechne ist Journalist durch und durch, und so setzt sein Buch vor allem auf Verständlichkeit, ohne dabei zu vereinfachen. Seine Stärken sind präzise Beobachtung und eine Sprache, die den Leser an allen Entdeckungen, Rückschlüssen und Vermutungen teilhaben lässt.
Einen weiteren Zugang eröffnet der im vergangenen Jahr verstorbene Robert Gernhardt mit seiner Doppel-CD „Ein dreifach Tusch für Wilhelm Busch.“, die bereits vor einigen Jahren erschienen ist. Der Busch-Preisträger 2006 beschäftigt sich – sein Hörbild ist gegliedert in vier Abschnitte – mit dem Satiriker, dem Humoristen und dem Komiker Wilhelm Busch. Das allein lohnte die Anschaffung der CD allemal, doch spannend ist der Anhang. Im Gespräch mit Heiner Boehnke erklärt Gernhardt kurz, knapp, pointiert und zudem sehr unterhaltsam, was den Zeichner, den Dichter und den Maler Busch ausmacht. Kein Kunstgeschichts-Studium vonnöten und dennoch fundiert.
Der Geburtsort Buschs – Wiedensahl – ist die dritte Variante, Zugang zur Mehrfachbegabung Busch zu finden. Umschauen, erleben aufnehmen – das gibt schon einen Eindruck davon, wie die Bilder und Geschichten zustande gekommen sind, die später kulturelles Allgemeingut geworden sind.
Der vierte Weg führt über Hannover. Dort stellt das Wilhelm-Busch-Museum zu Ehren seines Patrons Zeichnungen und Bilder in gleich zwei Ausstellungen aus. Unter dem Motto „Pessimist mit Schmetterling“ werden mehrere hundert Gemälde, Zeichnungen und Drucke unter den Ausstellungstiteln „So viel Busch wie nie“ – was auch quantitativ durchaus wörtlich genommen werden darf – und „Avantgardist aus Wiedensahl“ zur Schau gestellt.
Was aber ist avantgardistisch an einem Mann, dem gleich zwei Kritiker bescheinigen, sich vor allem an der flämischen Schule ausgerichtet, gar epigonal gemalt zu haben? Tschechne schreibt in den „Spuren“: „Busch und die Malerei – das ist ein ewiger Kreislauf von Aufbruch und Entmutigung.“ Er zitiert Busch: „Ich befinde mich hier in Antwerpen sehr wohl u. kann mich nicht genug freuen, daß ich hier mit meinen Malstudien den Anfang gemacht habe. Jedenfalls lerne ich hier in einem halben Jahr eben so viel als ich Düßeldorf in einem ganzen gelernt haben würde.“ Soweit 1852 der junge Kunststudent über seine Aussichten. Als Maler jedenfalls hat er keinen Weltruhm erlangt.
„Nun ja, also als Maler ist er, wenn man so will, gescheitert“, attestiert Gernhardt im Gespräch mit Boehnke dem von ihm sehr verehrten Busch. „Er hat, glaube ich, in seinem Leben kein Bild verkauft.“ Und über die Bilder des Vorgängers äußert sich – in einem einige Jahre zurückliegenden Urteil, also ohne Bezug auf die aktuelle Ausstellungen in Hannover – der Frankfurter Kritiker, der, nebenbei, selbst einmal Malerei studiert hatte, dann aber wie Busch als Zeichner, Humorist und Dichter berühmt wurde: „Dass es jetzt ein Wilhelm-Busch-Museum gibt, dass die zeigt, ist sehr verdienstvoll, aber natürlich würde man die nicht in der Weise ausstellen, wenn es nicht den genialen Zeichner, komischen Zeichner Busch gäbe.“
Das Ganze hat in der Tat die von Tschechne beschriebene Tragik, den Hinweis darauf gibt Busch selbst in der letzten Fassung seines Selbstportraits „Von mir über mich“ von 1894: „Nachdem ich mich schlecht und recht durch den Antikensaal hindurchgetüpfelt hatte, begab ich mich nach Antwerpen in die Malschule, wo man, so hieß es, die alte Muttersprache der Kunst immer noch erlernen könne. In dieser kunstberühmten Stadt sah ich zum ersten Male die Werke alter Meister: Rubens, Brouwer, Teniers, Frans Hals. Ihre göttliche Leichtigkeit der Darstellung malerischer Einfälle, verbunden mit stofflich juwelenhaftem Reiz; diese Unbefangenheit eines guten Gewissens, welches nichts zu vertuschen braucht; diese Farbenmusik, worin man alle Stimmen klar durchhört, vom Grundbaß herauf, haben für immer meine Liebe und Bewunderung gewonnen.“ Und an anderer Stelle seiner knappen Autobiografie: „Von Lüthorst ging ich nach München. Indes in der damaligen akademischen Strömung kam mein flämisches Schiffchen, das wohl auch schlecht gesteuert war, nicht recht zum Schwimmen.“
Das wohl, dort hat aber Busch auch zu einer völlig neuen Darstellungsform gefunden, diese geprägt, die bis dahin unbestritten gültige Spaltung von Bild- und Wortkunst überwunden. Busch über das Entstehen der später so weltberühmten Bildergeschichten in „Von mir über mich“: „Die Situationen gerieten in Fluß und gruppierten sich zu kleinen Bildergeschichten, denen größere gefolgt sind. Fast alle hab ich, ohne wem was zu sagen, in Wiedensahl verfertigt.“
In Fluss geraten indes ist dabei noch sehr viel mehr. Busch hat nicht nur Genre-Grenzen überwunden, Dicht- und Zeichenkunst miteinander vereinigt, sondern den Grundstein für völlig neue Darstellungsformen gelegt. Gernhardt beschreibt auf der „Tusch“-Aufnahme, wie Busch die Grundlage für spätere Comics schuf: „Und so hat er ja unendlich viele Figuren, also er hat ja einen ganzen Kosmos von Figuren in die Welt gesetzt und die alle noch animiert. Also das ist etwas, was dann später ja in die Technik, in die Filmsprache übergegangen ist, die Animation, also das Beseelen, das hat er mit seinen stehenden Bildern gemacht, die wären ja auch ganz leicht ins Laufen zu bringen, also die könnte man als Eckphasen für einen Trickfilm benutzen. Er hat ja auch sehr, sehr filmisch gesehen schon, bevor es den Film überhaupt gab. Er hat die Großaufnahme eingesetzt, er hat die Totale eingesetzt, er hat also leise Schwenks eingesetzt, das müsste man allerdings im Fernsehen einmal vorführen, wie er da gearbeitet hat.“ Dabei habe, so Gernhardt, einen „traumwandlerisch sicheren“ Strich gehabt, sei ein „Naturgenie des Zeichnens“ gewesen und habe mit komischer Kunst vieles vorweg genommen, was die Hochkunst erst im 20. Jahrhundert eingeholt habe. Die beiden weltberühmten Lausbuben zum Beispiel, die durch den Kamin ins Mehl gefallen sind, Kopf nach unten, das sei ein vorweggenommener Baselitz. Dabei habe Busch jedoch nie eine Figur oder Idee zu Tode geritten und als Hochkomiker „unglaublich redlich gearbeitet“.
Das Witzige an Gernhardts Witz ist, dass man nie weiß, wo die Ernsthaftigkeit endet und die Parodie beginnt. Genau wie bei Busch. Der Gedanke aber ist es wert, weiter gesponnen zu werden: Weltruhm mit neuer Kunst, neuem Ansatz. Nur: Wie zufrieden konnte Busch damit sein? Der Begriff „brotlose Kunst“ kommt nicht von ungefähr, wenn er auch beim Wiedensahler überhaupt nicht zutrifft, haben den doch seine Bildergeschichten und die Dichtung nicht nur zu einem berühmten, sondern auch zu einem wohlhabenden Mann gemacht. Aber komische Kunst? Heute noch nur wenig gut beleumundet, kaum, dass das Feuilleton – von Gernhardt, Waechter und Bernstein vielleicht abgesehen – davon überhaupt Kenntnis nimmt, geschweige denn hat. Eckhard Henscheid hat einmal Klage darüber geführt, dass kaum ein Dutzend Feuilletonisten in Deutschland überhaupt zwischen Humor, Satire, Komik, Parodie und anderen Spielarten zu unterscheiden wisse. Das wird zu Buschs Zeit kaum besser gewesen sein.
Erfolgreich ja, bekannt – unbedingt. Wenn es auch sonst keine Bücher in einem deutschen Haushalt gibt, das Backbuch von Dr. Oetker und ein Busch-Hausalbum werden sich immer finden. Aber ernsthafte Anerkennung? Busch hat sich auch nicht weiter darum bemüht, seine Bilder nicht der öffentlichen Kritik gestellt. Nie gab es zu Lebzeiten eine Ausstellung, und verkauft, wie Gernhardt vermutete, hat er auch nichts. Deshalb ist der Titel der zweiten aktuellen Ausstellung in Hannover – „So viel Busch wie nie – völlig berechtigt. „Nur ganz wenige Menschen, die ihm nahe standen, wussten, dass er nicht nur Bildergeschichten zeichnete, sondern ein ernsthafter Maler war“, lässt sich der Direktor des Wilhelm-Busch-Museums, Hans Joachim Neyer, zitieren.
Das ist heute noch so. Und wenn auch jeder Zeitgenosse Buschs dessen Entwicklung als Schöpfer einzigartiger Bildergeschichten verfolgen konnte, ist der Umstand, dass Busch auch in der Malerei ein Erfinder war, bis heute weitgehend unbekannt geblieben. Dabei sind – vielleicht nicht in demselben Maße, wie bei der Erfindung des Genres Bildergedicht – auch dort Dinge in Fluss geraten. Sorgsam und naturgetreu sind die frühen Zeichnungen und Bilder. Viele Zitate und Anleihen an frühere Epochen der Kunstgeschichte finden sich dort, auch für den Laien leicht zu ermitteln. Vor allem die Liebe zur flämischen Malerei bricht sich immer wieder Bahn, zumindest in den frühen Bildern.
Später aber gibt es zwei Bewegungen in Busch-Bildern, die scheinbar auf ein Zentrum hinsteuern: Die Formate werden kleiner, der Strich stärker. Das Ergebnis sind Bilder von beeindruckender Expressivität, und schließlich, gegen 1890, malt Busch in einem Maße abstrakt, dass es auch Fachleuten schwer fällt zu entscheiden, ob ein Bild hoch oder quer zu hängen ist. „Bäuerin im Stall/Sonnenaufgang“ ist ein Bild betitelt, das in der Tat beide Deutungen zulässt, abhängig davon, ob das Bild quer (Sonnenaufgang) oder hoch (Bäuerin im Stall) angebracht ist. Die Museumsbesucher können das selbst auch anhand einer Reproduktion des Bildes „Waldlichtung mit Rotjacke“ ausprobieren. Dinge geraten in Fluss. Zum Schluss zeichnet Busch abstrakt in einem Maße, wie es in der europäischen Malerei erst etwa 30 Jahre später, Anfang des 20. Jahrhunderts, en vogue war.
Und noch in einer weiteren Sparte war Busch seiner Zeit weit voraus. Als Maler, Zeichner und Erfinder des Comics wird er in den aktuellen Ausstellungen im Busch-Museum ausführlich gewürdigt. Auch die „vierte Dimension“, Busch als Prosa-Autor, wird aufgearbeitet, ist als Installation fast selbst Kunst. „Eduards Traum“, Buschs surreales Prosawerk – auch darin seiner Zeit eine Reihe von Jahren voraus -, hat im Auftrage des Museums Eckhard Siepmann zu einer Installation verarbeitet, die sich über drei Kabinette erstreckt. Das ist nicht nur aufregend umgesetzt, sondern erleichtert den Zugang zu diesem so verschlüsselten Werk ungemein.
Von spätem Ruhm haben Verstorbene in der Regel nichts. Zudem steht auch gar nicht zu befürchten, dass der Wiedensahler nachträglich in Reihe mit Rubens und Hals gerückt wird. Buschs 175. Geburtstag und die damit einhergehenden Ausstellungen, Veröffentlichungen und Würdigungen bieten jedoch die Chance, sich nicht nur mit dem Erfinder des Comic Strips auseinanderzusetzen, sondern auch kunstgeschichtlich Spannendes zu erfahren. Egal, ob man sich für flämische Malerei oder schnell gezeichnete Konturwesen begeistert, die den Gesetzen der Schwerkraft trotzen.

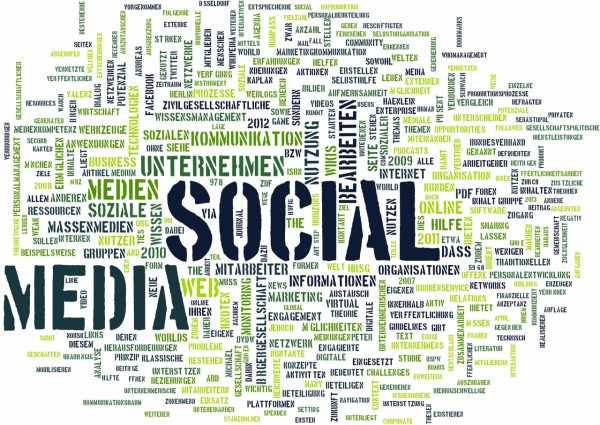
Neueste Kommentare